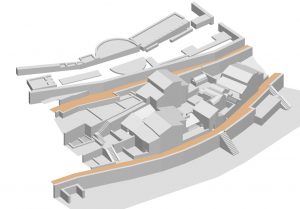Gustav Klimt und die byzantinische Kunst: Der Baum des Lebens im Mosaik-Fries des Stoclet-Palastes, Brüssel
15. November 2018, Dr. Jenny Albani, Athen (Halle):
Der in der Bibel erwähnte Baum des Lebens, der nach patristischen Interpretationen allegorisch und typologisch mit Christus, dem Heiligen Kreuz und Reliquien des Heiligen Kreuzes in Zusammenhang steht, taucht oft in der christlichen Kunst auf. In Byzanz wurde er oft nach antiken orientalischen Vorbildern zwischen Löwen, Vögeln oder Sphinxen dargestellt. Der vom österreichischen Künstler Gustav Klimt zwischen 1905 und 1911 entworfene Wandfries des Stoclet-Palastes in Brüssel besteht aus drei Mosaiktafeln, die den Speisesaal der luxuriösen Residenz des Großindustriellen Adolphe Stoclet verzierten. Der Vortrag befasst sich mit der Frage, ob byzantinische Einflüsse auf die Ikonographie und den Stil des “Stoclet Frieses” zu erkennen sind, auf dem der Baum des Lebens als zentrales Bildthema auftritt. Es ist bereits bekannt, dass die byzantinischen Wandmosaiken, die Klimt während seiner Reisen nach Venedig und Ravenna (1890 und 1903) bewunderte und studierte, eine morphoplastische Rolle in den Werken seiner sogenannten “goldenen Periode” (1899-1910) spielten. Die byzantinischen Emails, die in San Marco erhalten geblieben sind, könnten auch dem Künstler als Inspirationsquelle gedient haben. Darüber hinaus weisen die symbolischen Elemente des Stoclet-Frieses darauf hin, dass Klimt sich mit der frühchristlichen und mittelalterlichen Ikonographie gut auskannte.
Dr. Jenny Albani: Studium der Architektur an der Nationalen Technischen Universität Athen und der Kunstgeschichte an der Universität Wien. 1986: Promotion mit der Arbeit „Die Architektur und die Wandmalereien der Kirche der Panagia Chrysaphitissa auf der Peloponnes“. 1987-1991 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstgeschichte der Nationalen Technischen Universität Athen. Seit 1992 Angestellte des Griechischen Ministeriums für Kultur und Sport – Direktion für Museen – Abteilung für Sonderausstellungen und Museologischen Forschung. Seit 2001 parallel Tutorin an der Griechischen Offenen Universität – Fakultät für Geisteswissenschaften. Autorin von Büchern, Handbüchern und Aufsätzen über die byzantinische Kunst und Architektur. Kuratorin von Sonderausstellungen über die byzantinische Kultur.
Auswahlliteratur: Chr. M. Nebehay, Gustav Klimt Documentation, Wien 1969. – R. S. Nelson, “Modernism’s Byzantium, Byzantium’s Modernism”, in: Byzantium/Modernism. The Byzantine as Method in Modernity (hg. von R. Betancourt, M. Taroutina), Leiden, Boston 2015, 15-36. – C. E. Schorske, Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture, New York 1980. – M. E. Warlick, Mythic Rebirth in Gustav Klimt's Stoclet Frieze: New Considerations of Its Egyptianizing Form and Content, The Art Bulletin Bd. 74, Nr. 1 (März 1992) 115-134.